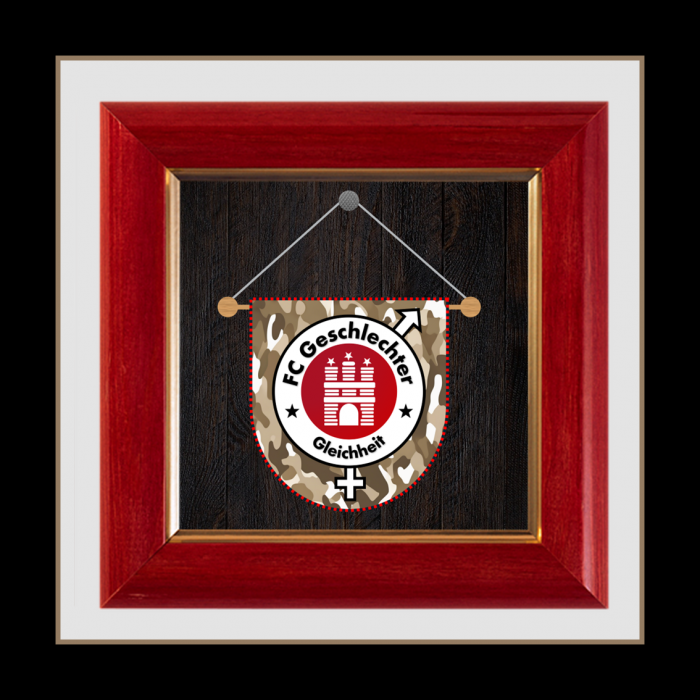Sport ist gesund
Sport ist gesund. Allein in Deutschland betreiben daher Millionen Menschen täglich Sport. Ein tragender Gesundheitsaspekt ist dabei, dass Bewegung und sportliche Aktivität unseren Kreislauf und unseren Stoffwechsel anregen. Dies betrifft auch unser Immun- und Entgiftungssystem (z.B. bestimmte Leber- und Nierenfunktionen). Vorausgesetzt natürlich, wir ernähren uns gesund und nehmen ausreichend Flüssigkeit zu uns.
If you want to read this article in English, please click here!
Eine Reihe weiterer, der Sportmedizin bekannten Faktoren, wirken sich positiv auf unseren Organismus und somit auf unser Leistungsvermögen aus. Hierzu zählt vor allem auch, was der Volksmund „frische Luft“ nennt. Die gängigste Definition von frischer Luft ist eine Kombination aus einer (sehr) guten Luftqualität und verschiedenen vitalisierenden Umweltfaktoren wie dem Sonnenlicht (Beispiel: Vitamin-D-Produktion).
Jedoch ist es leider auch so, dass sich die Luftqualität insbesondere in urbanen Zentren immer weiter verschlechtert. Einerseits ist der moderne Mensch, trotz der steten Verbesserung der Medizin, anfälliger gegenüber natürlichen Umwelteinflüssen geworden, wie z.B. den Pollen, Sporen oder Viren. Andererseits treten auch menschengemachte Belastungen in deutlich höherem Ausmaß auf. Hierzu gehören auch Schadstoffe mit teilweise ernsten gesundheitlichen Folgen.
Neben diversen bekannten chemischen Verbindungen, die z.B. durch Altlasten in bestimmten Regionen oder durch Zusatzstoffe in Materialien auftreten können, sind auch neuere Belastungen wie zum Beispiel Nano- und Mikroplastik zu einem großen Thema geworden, das auch im Sport Einzug hält. Auf der einen Seite sehen wir im Sport immer mehr Überlegungen und Bemühungen, unser Verhalten möglichst gesund und umweltfreundlich zu gestalten und Kreisläufe im Sinne der Nachhaltigkeit zu schließen, so wird beispielsweise recyceltes Plastik dazu verwendet Kunstrasen herzustellen. Auf der anderen Seite können durch synthetische Materialien auch Schadstoffe in die Umwelt gelangen, die negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben können.
Welche Schadstoffbelastungen können beim Sport auftreten?
Schadstoffe gibt es viele. Gesetze, wie das Chemikaliengesetz (ChemG), die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), das Arbeits(platz)schutzgesetz (ArbSchG, ArbPlSchG) oder das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und weitere Direktiven sollen uns und unsere Umwelt schützen. Sie geben zum Beispiel Grenzwerte vor. Die so festgelegten erlaubten Höchstkonzentrationen der jeweiligen Stoffe im Wasser, in der Luft, im Boden und in Produkten müssen verbindlich eingehalten werden. Wegen der Vielfalt der (neuen und alten) Stoffe und ihres oft unbemerkten Auftretens, kommt es allerdings immer wieder zu Lücken, auch wenn das Schadstoffvorkommen flächendeckend erfasst und überwacht wird.
Die folgenden Beispiele zeigen (auf der Basis einer persönlichen fachlichen Einschätzung) eine Auswahl von Schadstoffen, die in diesem Zusammenhang im Sport relevant sein können.
Sportutensilien, insbesondere einige ältere Modelle, können diverse Schadstoffe enthalten, die entweder unbeabsichtigt aus der Umwelt in/auf die Materialien gelangen oder diesen aufgrund ihrer Funktionalität als Materialbestandteile beigemengt werden. Je nach Zusammensetzung der Sportutensilien, deren Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen, können diese Stoffe dann nach der Auslieferung während der Nutzungsphase in unterschiedlichen Mengen wieder freigesetzt werden.
Die nachfolgenden Sportutensilien stegen daher im Verdacht häufig Schadstoffe zu enthalten:
- Plastikflaschen und -Behälter: Kunststoffe enthalten neben strukturgebenden (Polymer-)Bestandteilen auch Zusatzstoffe wie Weichmacher, die je nach Substanzklasse und Formulierung, hormonelle Aktivität aufweisen können (#EndokrineDisruptoren). Wenn diese Stoffe z.B. über Getränke aufgenommen werden, kann dies zu hormonellen Ungleichgewichten führen und unseren Körper unter Umständen auch langfristig negativ beeinflussen.
- Funktionsbekleidung aus Synthetik: Abgesehen von der Kunstfaser selbst können in Textilien u.a. Flammschutzmittel, Kleb- und Farbstoffe, oder Kunststoff-typische Chemikalien wie Phtalate, enthalten sein. Diese können über die Haut aufgenommen werden und kurzfristig Irritationen und Allergien begünstigen bzw. diese hervorrufen.
- Weitere Sportutensilien (mit häufigem Hautkontakt) wie Bälle, Schläger, Matten, Brillen, Helme, Mundschutz, usw. können ebenfalls einige der zuvor genannten Schadstoffgruppen enthalten und unter Umständen zur Gesamtbelastung von Sportler:innen beitragen.
Wichtig zu beachten ist, dass die Gesetzgebung moderne Standards setzt, und dass das Verantwortungsbewusstsein verschiedener Hersteller die Verwendung von schädlichen Chemikalien in Sportutensilien reduziert (vergl. #CSR Directive, ISO/EN/DIN-Normen oder MAK-Werte der Berufsgenossenschaften). Wenn man Sportausrüstung kauft ist es deshalb ratsam auf entsprechende Zertifizierungen und Hinweise auf schadstofffreie Materialien zu achten (siehe Abschnitt „Handlungsempfehlungen”). Zudem gibt es inzwischen einige weitere Initiativen und Unternehmen, die sich mit der (Weiter-)Entwicklung umweltfreundlicher und gesundheitsverträglicher Sportutensilien befassen.
Neben produktspezifischen Schadstoffvorkommen können auch potentielle Belastungen von Sportplätzen und öffentlichen Räumen gesundheitlich problematisch sein. Sie können z.B. durch Luftverschmutzung mehr oder minder stark beeinträchtigt werden. Schadstoffe aus Verkehrsquellen (insbesondere Verbrennermotoren), Industrieemissionen und weiteren Quellen, können sich in der Luft anreichern und auf Oberflächen, einschließlich Böden und Pflanzen, ablagern.
In einigen Fällen kann der Boden selbst kontaminiert worden sein, wie z.B. durch eine unsachgemäße Entsorgung von Abfällen, industrielle Aktivitäten oder andere Umweltbelastungen. Ein relevantes Beispiel für Letztere sind Pflanzenschutzmittel (#Pestizide), die in der Landwirtschaft, im Gartenbau oder bei der Pflege öffentlicher Räume (z.B. Parkanlagen und Grünflächen) verwendet werden und dort je nach Stoffgruppe längerfristig zu erhöhten Schadstoffkonzentrationen am/im Boden und vorübergehend auch in der Luft führen können.
Folgende potentielle Schadstoffquellen sind beim Sport im Freien möglich:
- Sport an befahrenen Straßen bzw. in Smog-Gebieten: NOx, SOx, CO, Feinstaub (u. a. Rußpartikel) und Ozon.
- Rasenflächen (einschließlich Parks und Golfplätze): unsachgemäße und/oder übermäßige Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (z.B. durch Nutzung von Restbeständen inzwischen verbotener Stoffe/Mischungen)
- Kunststoffböden auf Freiplätzen: Phtalate, Flammenschutzmittel, Nano- und Mikroplastik können hier durch die mechanisch-physische Beanspruchung auch Jahre nach dem Verbau noch freigesetzt werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Freiplätze oder öffentlichen Räume zwangsläufig schadstoffbelastet sind. Viele Kommunen ergreifen Maßnahmen bzw. sind nach (Altlasten-)Erkundung dazu verpflichtet, die Auswirkungen auf Menschen und Umwelt einzudämmen und die Qualität ihrer öffentlichen Räume sicherzustellen.
Zusätzlich zu Freiräumen sind insbesondere auch die Belastung von Sporthallen und Innenräumen zu beachten. Diese können verschiedene Ursachen haben. Unterschiedliche Materialien, aus denen Sporthallen und Innenräume errichtet wurden, können dabei Schadstoffe enthalten und freisetzen. Dies kann von Farben, Lacken, Bodenbelägen, Dichtungsmitteln, Möbeln und anderen Baumaterialien ausgehen. Insbesondere ältere Gebäude könnten mit Materialien errichtet worden sein, die heute als gesundheitsschädlich bekannt oder sogar verboten sind. Wenn bestimmt Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel in Innenräumen verwendet werden, kann dies zu einer zusätzlichen Belastung mit schädlichen Chemikalien führen.
Nachfolgend werden potentiellen Schadstoffquellen im Innenbereich augelistet:
- Sporthallen mit Kunststoffboden (inklusive Teppichböden): Phtalate und Phenole können als flüchtige Verbindungen in die Raumluft gelangen. Nano- und Mikroplastik können durch Abrieb aufgewirbelt und eingeatmet werden.
- Sporthallen mit Holzboden (z.B. Parkett) bzw. Holzdecken: Holzschutzmittel (Biozide) wie das inzwischen verbotene Pentachlorphenol (PCP) und Lindan kommen aufgrund ihrer Langlebigkeit weiterhin häufiger vor und können sich daher in schlecht belüfteten Räumlichkeiten anreichern.
- Ältere Gebäude: Persistente Organische Schadstoffe (POPs) wie Polychlorierte Biphenyle (#PCBs), Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (#PAHs), Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (#PFCs bzw. #PFAS), Dioxine und Furane oder schädliche Fasern wie Asbest oder künstliche Mineralfasern (KMF) älteren Datums bzw. in bestimmten Größenverhältnissen.
- Regionale Besonderheiten: Ein schädliches chemisches Element, das in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erhielt, ist Radon. Radon ist Teil der natürlichen Erdstrahlung und strömt in bestimmten Regionen Deutschlands in erhöhten Konzentrationen aus dem Erdreich. Aktuell arbeitet man an einer #Radonkarte, die diese Gebiete ausweist und in denen ggf. eine Radonbestimmung angeraten wird.
Es ist wichtig zu betonen, dass moderne Baustandards und Umweltvorschriften dazu anhalten bzw. vorgeben, die Verwendung schädlicher Materialien zu begrenzen. Neuere Gebäude und Renovierungen berücksichtigen diese Umweltaspekte in der Regel im Voraus und legen dabei Wert auf eine gute Raumluftqualität (z.B. durch Lüftungen mit Wärmerückgewinnung). Es ist daher ratsam, bei der Auswahl von Baumaterialien, Reinigungsprodukten und Sportausrüstungen auf umweltfreundliche und schadstoffarme Optionen und Siegel zu achten, um die Belastung von Anfang an zu minimieren.
Auswirkungen der Schadstoffbelastung und Handlungsempfehlungen
Abgesehen von der bereits vorhandenen Schadstoffbelastung unseres Körpers (vgl. #HumanesBiomonitoring) können wir beim Sport also zusätzlichen Schadstoffen ausgesetzt sein. Nehmen wir diese auf, sind messbare negative Folgen für unsere Gesundheit vorprogrammiert. Die Folgen können dabei von geringfügigen Leistungseinbußen bis hin zu ernsthaften Langzeitrisiken reichen.
Daher sollten Sie als Sporttreibende, als Sportverein und als Fan das Thema auf dem Schirm haben und gegebenenfalls mit folgenden Maßnahmen einen Beitrag zur Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Sportler:innen und Zuschauer:innen leisten:
- Wenn Sie Sportausrüstung kaufen, sollten Sie darauf achten, umweltfreundliche Produkte zu wählen, die frei von schädlichen Chemikalien sind. Dies gilt insbesondere für Schuhe, Trikots und andere Artikel, die direkt mit der Haut in Kontakt kommen.
- Eine gute Belüftung von Innenräumen, aber auch großen Stadien, kann entscheidend dazu beitragen, Schadstoffbelastungen zu reduzieren. Es ist auch möglich, die Raumluftqualität mit kostengünstigen Messgeräten auf bestimmte Schadstoffe (z.B. flüchtige organische Verbindungen, VOCs) zu prüfen. Für Außengelände stehen hier sogenannte Air Quality Index (AQI) Apps zur Verfügung, in denen die Luftqualität eines bestimmten Standorts für ausgewählte Parameter angezeigt wird.
- Wenn ein Verein neue Sportanlagen oder Renovierungen plant, sollte er auf nachhaltige Baustandards und Materialien setzen. So kann er beispielsweise geprüfte Baustoffe, nicht-flakernden Beleuchtungssystemen sowie effiziente Belüftungssysteme verwenden.
- Sportanlagen regelmäßig zu reinigen und zu warten ist wichtig, um schädliche Ablagerungen zu minimieren. Umweltfreundliche Reinigungsprodukte zu verwenden, hilft dabei, die Belastung mit schädlichen Chemikalien zu minimieren. Im Verdachtsfall gibt aber auch eine kostengünstige Laborprobe Aufschluss über mögliche Kontaminationen.
Zudem ist ein entscheidender Faktor das Bewusstsein zu bilden. Sportvereine können ihre Mitglieder, Trainer:innen und Mitarbeiter:innen sensibilisieren. So können Sie jederzeit und mit einfachen Mitteln selbst aktiv werden.
Was meinen Sie? Diskutieren Sie mit! Wenn Sie über LinkedIn in Kontakt mit dem Autor Dr. Aennes Abbas treten möchten geht es hier lang.