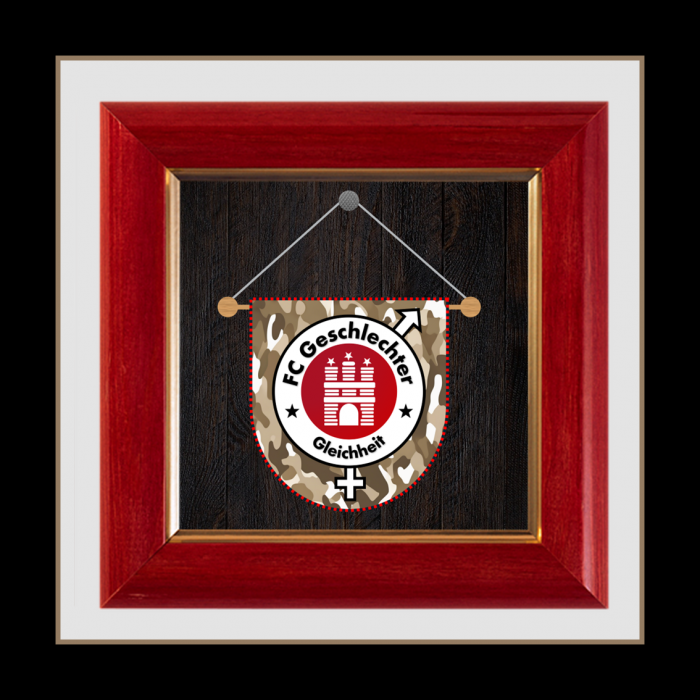FC Maßnahmen zum Klimaschutz: Die Bayern und SGD 13
Stell dir einen alten Bilderrahmen vor, zum Beispiel von einem Flohmarkt oder vom Speicher. Genau dieser Rahmen wird zur Bühne für eine neue Botschaft. Der FC Bayern engagiert sich im Bereich Klimaschutz. Beim Upcycling wird statt etwas Neues zu kaufen Bestehendes weiterverwendet. Glas und Rahmen bleiben mit all ihren Gebrauchsspuren und Erinnerungen erhalten, doch das Bild darin wird komplett neu gestaltet. Entstehen soll ein Motiv, das die Bildsprache des FC Bayern aufgreift und neu interpretiert.
Hinter der Lichtshow: Die Klimastrategie „Mitnand“ und der CO₂-Fußabdruck
Wenn man abends an der Allianz Arena vorbeifährt, sieht man zuerst nur ein riesiges leuchtendes Stadion im Münchner Norden. Was man nicht sieht: Hinter der Lichtshow steckt eine ziemlich konsequente Klimastrategie des FC Bayern – festgeschrieben in der Nachhaltigkeitsstrategie „Mitnand“ und im dazugehörigen Bericht. Der Club beschreibt dort, dass er Klima- und Umweltschutz vor allem als Aufgabe versteht, die eigenen Treibhausgas-Emissionen zu senken, und dafür systematisch seinen CO₂e-Fußabdruck berechnet. Für die Saison 2021/22 lag dieser für den gesamten Verein – also AG, e.V. und Basketball GmbH – bei 75.966,26 Tonnen CO₂e, Grundlage ist das Greenhouse Gas Protocol. Dieses Zahlenwerk ist kein Selbstzweck, sondern die Basis, um Reduktionspotenziale zu finden und Maßnahmen zu steuern.
Energie neu denken: LED-Fassade, Ökostrom und Photovoltaik beim FC Bayern
Am sichtbarsten wird das beim Stadion selbst. Seit 2006 ist die Allianz Arena EMAS-zertifiziert und verpflichtet sich damit, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Ein zentraler Hebel ist das Thema Energie. 2015 wurde die komplette Außenfassade auf LED-Technik umgestellt – laut einem Bericht der Abendzeitung spart das rund 60 Prozent Energie im Vergleich zur alten Beleuchtung. Gleichzeitig arbeiten die Bayern daran, den Strom so sauber wie möglich zu beziehen: Geschäftsstelle an der Säbener Straße, FC Bayern Campus und Allianz Arena laufen laut demselben Bericht zu 100 Prozent mit Ökostrom. Parallel dazu baut der FC Bayern schrittweise eigene erneuerbare Erzeugung auf. Arena-Geschäftsführer Jürgen Muth verweist darauf, dass seit 2019 eine große Photovoltaik-Dachanlage mit 850 kWp auf dem Gästeparkhaus der Allianz Arena in Betrieb ist und eine weitere Anlage ähnlicher Größe im Eingangsbereich Süd geplant ist. Dazu kommen zwei PV-Anlagen an der Säbener Straße und eine am Campus. Im Nachhaltigkeitskonzept tauchen diese Projekte unter dem Handlungsfeld „Energie & Wasser“ auf: Ressourcenverbrauch – Treibstoff, Licht, Wärme, Wasser, Strom – soll zunächst reduziert, danach der Anteil erneuerbarer Energien wie Solarstrom erhöht werden.
Wärme ohne Fossile: Wärmepumpen und Effizienz in der Allianz Arena
Ein besonders spannender Baustein ist die Wärmeversorgung. In der Arena wird die Rasenheizung seit 2022 über eine Wärmepumpe betrieben; allein im ersten Jahr wurden damit laut Abendzeitung 750.000 Kilowattstunden Energie eingespart. Weitere Wärmepumpen sollen folgen, sowohl im Stadion selbst als auch an der Säbener Straße. Damit wird ein klassischer „Energie-Klima-Klotz“ – Wärme aus fossilen Brennstoffen – Schritt für Schritt auf eine erneuerbare Basis gestellt.
Mehr als Mülltrennung: Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft
Klimaschutz endet für den FC Bayern aber nicht bei Strom und Wärme. Im Nachhaltigkeitsbericht und auf der Klimaseite findet sich ein eigener Block zu „Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft“. Für die Saison 2022/23 hat der Verein an seinen drei Hauptstandorten – Allianz Arena, Säbener Straße, Campus – eine ausführliche Analyse des Abfallmanagements erstellt, um auf dieser Grundlage das Konzept weiterzuentwickeln und möglichst viel in Kreisläufe zurückzuführen. Das wirkt auf den ersten Blick weniger spektakulär als eine leuchtende Fassade, ist aber für die tatsächliche Klimabilanz wichtig: weniger Restmüll, bessere Trennung, mehr Verwertung.
Bayern-Biotop: Biodiversität am Campus und Schutz der Heidelandschaft
Ein anderes Kapitel im Nachhaltigkeitsbericht ist der Schutz der Biodiversität. Am FC Bayern Campus gibt es ein eigenes Biotop, das der Verein auf seiner Klimaseite als Beispielprojekt erwähnt. Was das konkret heißt, beschreibt erneut die Abendzeitung: Auf dem Gelände an der Ingolstädter Straße liegen rund sechs Hektar Naturschutzfläche; in diesem „Bayern-Biotop“ werden artenreiche Kalk-Magerrasen wiederhergestellt und sensible Arten der Heidelandschaft geschützt und gefördert. Der Club betont, dass er dort gewonnene Erkenntnisse auf andere Standorte übertragen will – Klimaschutz und Artenschutz werden so zusammen gedacht.
Unterwegs mit weniger Emissionen: Klimafreundliche Mobilität rund um die Arena
Rund um die Arena spielt außerdem klimafreundliche Mobilität eine Rolle. Direkt vor dem Stadion gibt es einen HPC-Ladepark für E-Trucks und E-Busse, den der FC Bayern gemeinsam mit MAN eingerichtet hat. Das ist als Infrastrukturprojekt interessant, weil es nicht nur dem eigenen Betrieb nutzt (zum Beispiel für Mannschafts- oder Shuttlebusse), sondern auch als Angebot für Dritte fungiert – und damit das Umfeld des Stadions elektrifiziert.
Kreatives Upcycling: Ein Bilderrahmen als Statement für Klimaschutz
Dieses Upcycling-Projekt lässt sich mit wenig Aufwand umsetzen. Am Computer entsteht ein neues Design, das sich optisch an Anmutung und Stil des FC-Bayern-Logos orientiert, aber Inhalte wie Energieeinsparung, Ökostrom und umweltfreundliche Mobilität in den Mittelpunkt stellt. Ergänzt werden kann das Motiv durch einen Wimpel im Look eines Kulttrikots, auf dem etwa „Mitnand fürs Klima“ oder ein ähnlicher Slogan steht. Danach heißt es nur noch: Gestaltung ausdrucken, zuschneiden und in den alten Rahmen einsetzen – so wird aus einem einfachen Dekostück ein sichtbares Statement für Klimaschutz im Fußballalltag.
Du willst immer über die neusten Geschichten informiert sein? Dann folge uns!